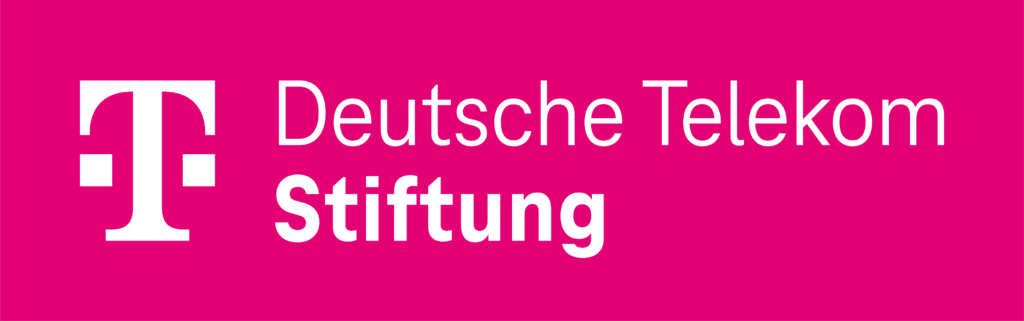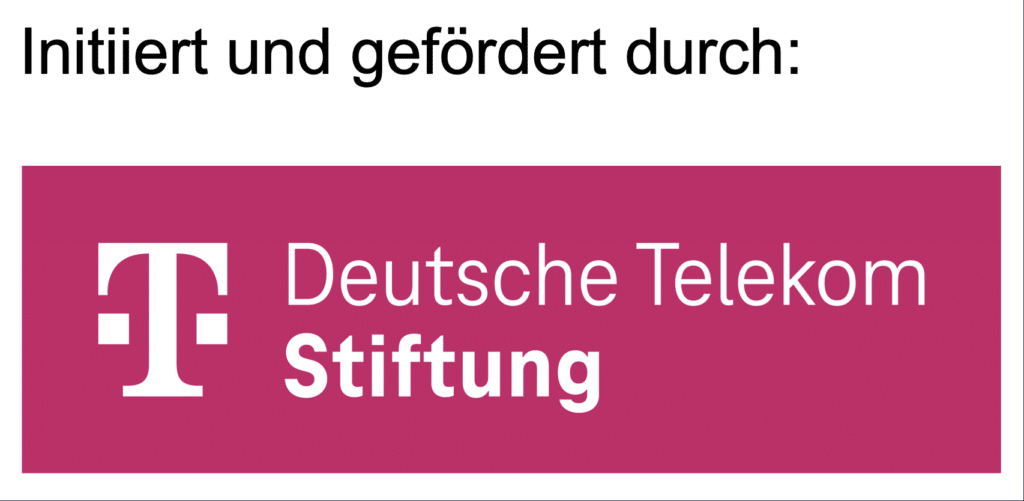Programmieren als Mittel zum Erkenntnisgewinn
Kurzbeschreibung:
In einer zunehmend digitalen und datengetriebenen Welt eröffnen digitale Tools vielfältige Möglichkeiten, persönlich oder gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu explorieren und aktiv als mündige, autonome und verantwortungsbewusste Bürger*innen an der Gesellschaft teilzuhaben. Das Konzept des Epistemischen Programmierens bietet einen Ansatz, der Lernende dazu befähigt, die Welt eigenständig zu erkunden. Programmieren wird hierbei zu einem erkenntnisgetriebenen Werkzeug, das nicht nur technische Fähigkeiten vermittelt, sondern gezielt die Entwicklung zukunftsrelevanter Kompetenzen im digitalen Zeitalter fördert.
In der Session wird nach einer Einführung in diesen erkenntnis- und interessenorientierten Programmieransatz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten aus interdisziplinären Citizen-Science-Modulen vorgestellt, die momentan im Rahmen des von der Deutschen Telekom Stiftung geförderten ProDaBi-Projekts (www.prodabi.de) entstehen.
Anschließend erhalten die Teilnehmenden Gelegenheit, selbst diesen Zugang des Epistemischen Programmierens auszuprobieren, indem sie Lernumgebungen ausprobieren, die die Exploration von Umweltdaten als erkenntnisorientierte Programmierpraktik fokussieren.
Im Anschluss werden gemeinsam Ideen für weitere (Programmier-)Projekte entwickelt, die die Exploration persönlich oder gesellschaftlich bedeutsamer Aspekte in den Mittelpunkt stellen. Ziel ist es, gemeinsam Perspektiven für die Förderung von Kompetenzen durch die Programmierung digitaler Artefakte zu erörtern und weiterzuentwickeln.
Einordnung des Beitrags in das Thema der Konferenz (Digitale Souveränität in der Schule)
Dieser Beitrag leistet einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität von Schulen, indem er aufzeigt, wie Programmieren als Werkzeug für die persönliche und gesellschaftliche Ideenexploration genutzt werden kann. Das Konzept des Epistemischen Programmierens befähigt Lernende, digitale Technologien nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv und kreativ einzusetzen. Dadurch entwickeln sie nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch Zukunftskompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Selbstregulation – essenzielle Bausteine für souveränes Handeln in einer digitalisierten Welt.
Die vorgestellten Unterrichtsmodule und Workshops verbinden Programmieren mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Umweltschutz und fördern so die Verknüpfung von digitaler Kompetenz mit demokratischer Partizipation. Insbesondere der niedrigschwellige Zugang zu den Tools ermöglicht es auch Lernenden ohne Vorkenntnisse, digitale Technologien selbstbewusst und reflektiert zu nutzen.
Für Lehrkräfte und schulische Akteure bietet der Beitrag praxisnahe Impulse, wie digitale Souveränität durch innovative Unterrichtsformate systematisch gefördert und nachhaltig in die Schulpraxis integriert werden kann. Dies unterstützt Schulen dabei, ihre Rolle als Lern- und Lebensorte in der digitalen Gesellschaft zukunftsorientiert zu gestalten.